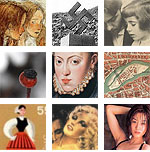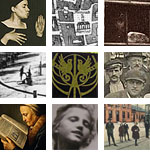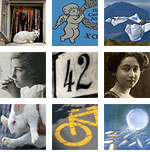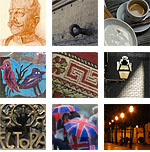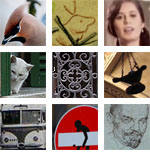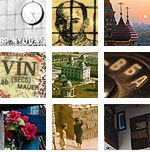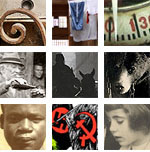![]() Zum ersten Mal stieß ich auf den Cirku in einem Foto auf einer italienischen Urbex-Website. Keine weiteren Angaben, nur die knappe Bildunterschrift: „Brutalistischer Zirkus in Albanien.“ Schon bald fand ich heraus, dass dieses Betonmonument im südalbanischen Patos steht, nur wenige Kilometer von den Ruinen des antiken Apollonia entfernt. Da unsere Route ohnehin dorthin führte, beschlossen wir, anzuhalten.
Zum ersten Mal stieß ich auf den Cirku in einem Foto auf einer italienischen Urbex-Website. Keine weiteren Angaben, nur die knappe Bildunterschrift: „Brutalistischer Zirkus in Albanien.“ Schon bald fand ich heraus, dass dieses Betonmonument im südalbanischen Patos steht, nur wenige Kilometer von den Ruinen des antiken Apollonia entfernt. Da unsere Route ohnehin dorthin führte, beschlossen wir, anzuhalten.
Patos gilt als Hauptstadt der albanischen Ölförderung. Die Stadt liegt über dem 1928 entdeckten Feld Patos-Marinëz, dem größten Onshore-Ölvorkommen Europas. Schon auf dem Weg dorthin begleiteten uns endlose Pumpenböcke und gewaltige, rostige Tanks. Die Luft war schwer vom scharfen Geruch des Rohöls.
Im Zentrum deutet nichts auf einen Zirkus hin. Doch ich hatte die Straßen vorher auf Google Views abgesucht und war fündig geworden: ein graues, vieleckiges Gebilde in einer Nebenstraße, der Rruga Çamëria.
 Und tatsächlich: Nach wenigen hundert Metern teilt sich die Straße, ein Ast schwingt sich halbkreisförmig um das gewaltige Betonskelett des Cirku.
Und tatsächlich: Nach wenigen hundert Metern teilt sich die Straße, ein Ast schwingt sich halbkreisförmig um das gewaltige Betonskelett des Cirku.
Große Gitterfenster laufen rund um das Gebäude, im Innern wachsen Feigenbäume. Ein rundes Dachfenster wird von Metallträgern eingefasst, die ein sternförmiges, ziehharmonikaartig gefaltetes Dach stützen. Auf der oberen Straßenseite liegt ein niedriger Eingangsbereich, unten ruht das Bauwerk auf mächtigen Betonpfeilern.
Ende der 1980er Jahre sollte der Cirku als Prestigeprojekt des kommunistischen Regimes entstehen – ein Versuch, die Stimmung in Zeiten der Krise zu heben. Patos war nicht nur Ölstadt, sondern auch Heimat der berühmten Zirkusbrüder Arnold und Artan Balla. Doch der Staat brach zusammen, bevor der Bau fertiggestellt war. Der Cirku öffnete nie und verfällt seitdem.
Ein albanischer Fernsehsender filmte das Gebäude kürzlich und stellte die Bilder auf YouTube. Spektakulär, doch nur mit albanischem Kommentar. Englische Untertitel sollen folgen.
Gleich nebenan erhebt sich ein weiteres Monument: ein rechteckiger Bau mit vorspringendem Obergeschoss auf Betonpfeilern. Durch ein Fenster entdeckten wir den Seniorenklub, Männer beim Schach und Domino. Wir wurden freundlich begrüßt, der Eingang jedoch lag auf der Rückseite.
Am Erdgeschoss empfängt uns die Leiterin des Jugendklubs. Früher, erzählt sie, sei das Gebäude das Kulturhaus der Stadt gewesen: mit Kino, Auditorium, Bibliothek, Clubs und Werkstätten. Patos war ein intellektuelles Zentrum, zog Ingenieure – „sogar russische und polnische“ – und Lehrer an, die für ein pulsierendes Kulturleben sorgten.
Mit dem Ende des Sozialismus kam der Niedergang. Die Ölindustrie ging an ausländische Investoren, die gebildete Schicht verschwand. Die Hälfte des Kulturhauses wurde privatisiert, samt Bibliothek – das Schicksal der Bücher bleibt unklar. Heute betreibt die Leiterin mit einigen Kollegen Kurse für rund fünfzig Kinder. Sie führte uns durch Zeichen-, Musik- und Tanzräume, zeigte stolz Fotos einer Aufführung in Tracht auf der großen Bühne.
Von dort aus – zwei Stockwerke über dem Haupteingang – öffnet sich der Blick auf Fototafeln voller Erinnerungen an Öl und Kultur. Kolleginnen kommen hinzu, reichen uns die Hand, froh über unseren Besuch.
Die Bühne selbst, einst Kino, wirkt verblasst, doch groß und eindrucksvoll.
Vom Dach aus sehen wir auf den Cirku und den Hof mit stillgelegtem Springbrunnen und Bänken – heute der Hof des Seniorenklubs.
Dort trifft uns der Fotograf der Stadtverwaltung, der ein Gruppenbild für die Lokalzeitung machen will. Fremde, die aus Neugier nach Patos kommen, sind eine Seltenheit.
Im Kulturhaus wirft uns ein Klassenzimmer einen weiteren Blick auf das Leben der Stadt: Kinder lernen albanische Volkslieder von alten Ölarbeitern. Ein Junge rezitiert, die Alten singen den Refrain.
Eine energische Lehrerin dirigiert die Kinder wie ein Hirtenhund, erinnert uns an unsere Grundschulzeit. Für uns stimmen sie ein Willkommenslied an. Als ich sie fotografieren will, schiebt die Lehrerin die Kinder nach vorn und verschwindet hinter ihnen.
Wir verabschieden uns dankbar von ihr und der Direktorin. Was sie hier für die Kinder dieser vergessenen Ölstadt leisten, ist unschätzbar. Sollte es den Jungen und Mädchen gelingen, einmal aus diesem Umfeld auszubrechen, dann vor allem dank ihnen.
Wir fahren weiter – erfüllt von Freude. Wir waren gekommen, um Verfall zu sehen, und fanden stattdessen Leben.